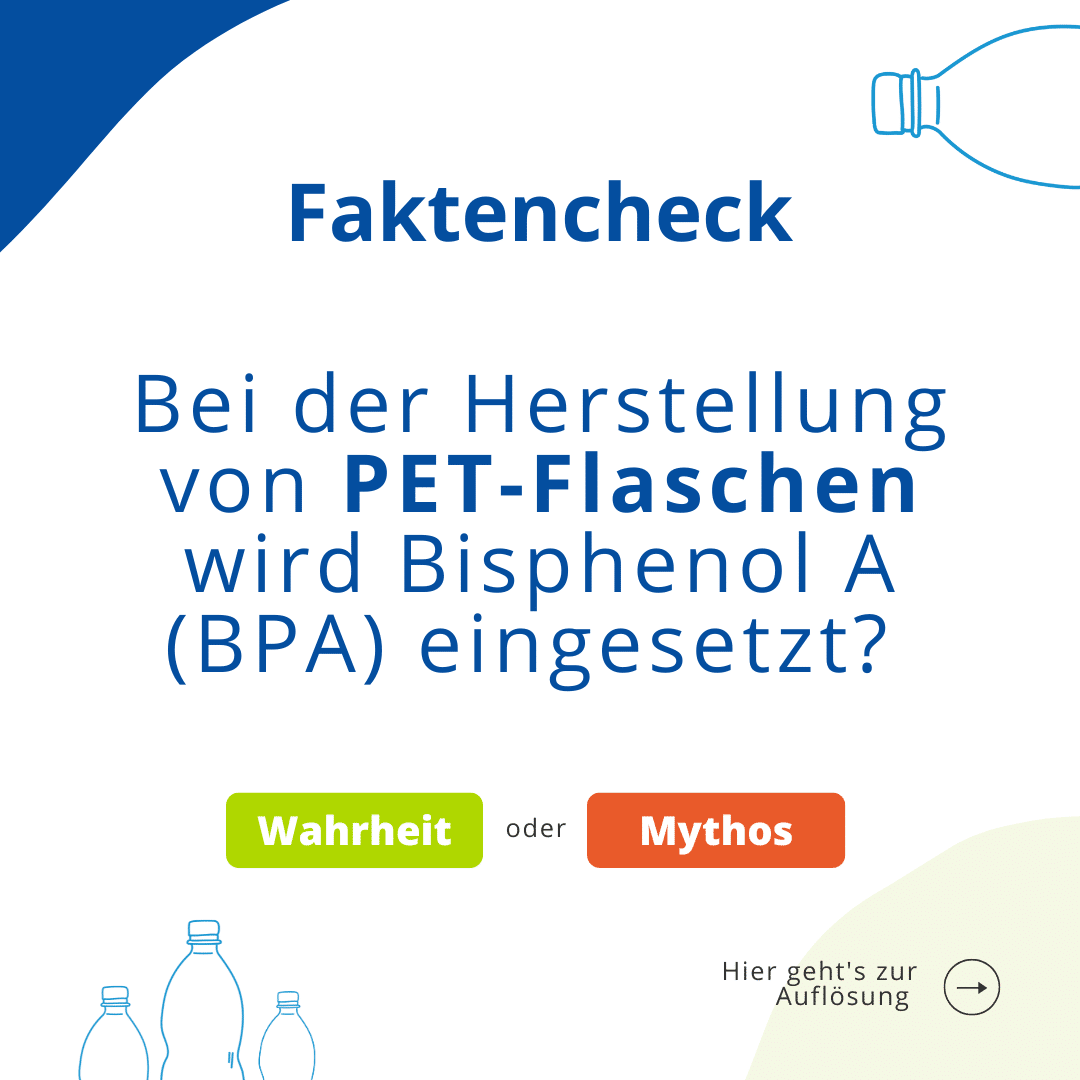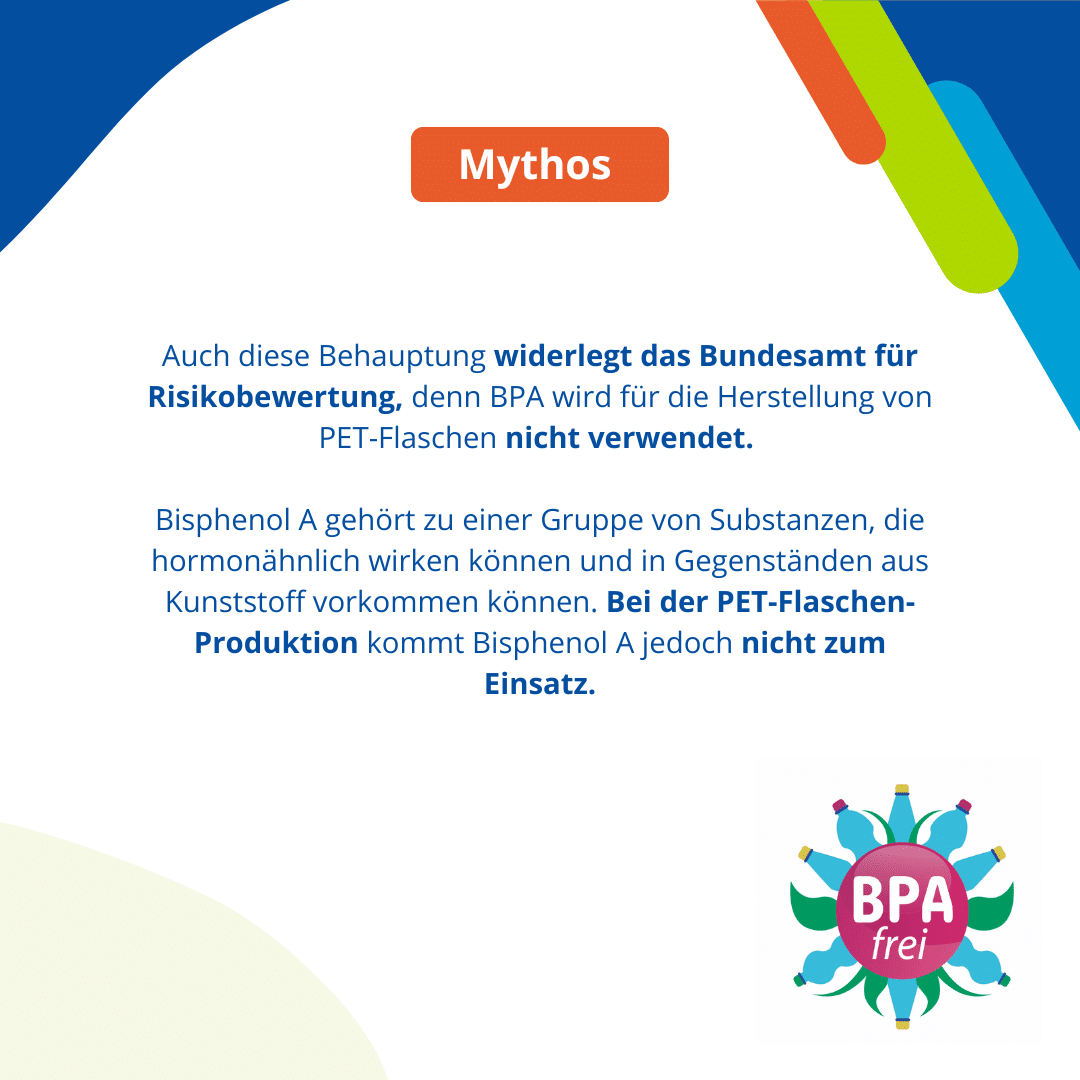Dr. Sieglinde Stähle, Wissenschaftliche Leitung im Lebensmittelverband e. V. (ehemals BLL e. V.), ist Diplom-Lebensmittelingenieurin und seit 1990 zuständig für die Bereiche Lebensmittelhygiene, Lebensmittelkontaktmaterial und -verpackungen sowie Standardisierungen. Zugleich erschloss sie für den Verband durch Weiterbildung das Thema Qualitätsmanagement, weshalb dieser heute auch die Normung in der Branche mit begleitet. Im Interview mit der IK spricht Dr. Sieglinde Stähle über die Rolle von Bisphenol A (BPA) im Lebensmittelkontakt, die entsprechende EU-Verordnung und die Herausforderungen für die Branche.
Die zulässige Menge von BPA im Lebensmittelkontakt ist mit der aktuellen EU-Verordnung (EU) 2024/3190 neu geregelt. Sie legt eine tolerierbare tägliche Aufnahmemenge (TDI) für BPA auf 0,2 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag fest. Basis war unter anderem die Konsultation mit der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), die die Menge im Jahr 2025 selbst mit 4 Mikrogramm bewertete. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) plädiert für 200 Nanogramm.
Auch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) vertritt, wie das BfR, eine andere Auffassung zur verwendeten Methodik. Wie lassen sich diese enormen Abweichungen erklären?
Vereinfacht gesagt legt die EFSA ein Gramm als giftig fest, das BFR ein Kilo. Ein derartiger wissenschaftlicher Dissens müsste eigentlich aufgelöst werden. Das ist aber nicht geschehen. Für mich ist die BfR-Ableitung die plausiblere. Das BfR hat in seinen Berichten aufgezeigt, wo die Schwächen in der EFSA-Bewertung liegen: Beispielweise wurde die Auswahl der zugrunde liegenden Studien nach politischen Vorgaben der Kommission eingeschränkt – und andererseits Studien berücksichtigt, die nicht qualifiziert und wissenschaftlich belastbar waren. Dass diese drastischen Unterschiede in der Bewertung so stehen bleiben, ist ein Armutszeugnis für die Wissenschaftsbehörden. Ein wissenschaftlicher Auftrag beinhaltet, genau an dieser Stelle noch einmal in die Analyse zu gehen und gemeinsam zu sehen, welche Bewertung man als Wissenschafts-Community vertritt. Das wäre meines Erachtens folgerichtig gewesen.
Das Thema BPA im Lebensmittelkontakt war in den vergangenen Jahren immer wieder Gegenstand des öffentlichen und politischen Diskurses. Die Europäische Kommission hat 2024 eine Verordnung für ein Verbot der absichtlichen Verwendung von BPA zur Herstellung von Lebensmittelbedarfsgegenständen erlassen.
Wie ordnen Sie die neue Regulatorik aus Sicht Ihrer Branche ein – ist sie gerechtfertigt?
Zunächst ist es wichtig, verschiedene Expositionswege von BPA im Lebensmittelkontakt zu betrachten: Entweder eine Migration, die während der Produktion oder durch die Verpackung geschehen kann, oder Expositionen über Luft, Wasser und Umwelt. Hier gilt es jeweils unterschiedliche Maßstäbe anzulegen. Basierend auf der Einordnung durch die EFSA, die politisch und auch wissenschaftlich sehr umstritten ist, hat die Politik den Bereich Lebensmittelkontaktmaterial geregelt, um für Entlastung zu sorgen. Doch nachvollziehbar ist die Ausgestaltung dieser Verordnung nicht. BPA wurde durch NGOs gezielt als unerwünschte und gefährliche Chemikalie positioniert. Diese Einordnung trägt dem aktuellen Stand der Wissenschaft nicht Rechnung. BPA gehört zu den am besten untersuchten Chemikalien.

Logo Lebensmittelverband Deutschland
Über den Lebensmittelverband Deutschland:
Der Lebensmittelverband Deutschland ist der Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft. Er vereint Verbände und Unternehmen der gesamten Lebensmittelketteaus Landwirtschaft, Handwerk, Industrie, Handel und Gastronomie.
Welche Bedeutung hat die Verordnung für Lebensmittelhersteller?
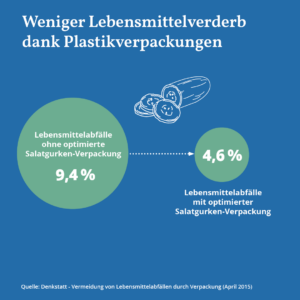 Zum Teil müssen Produktionsanlagen mit BPA-haltigen Bauteilen umgerüstet und alternative Materialien gefunden werden. Das bedeutet höhere Kosten, Aufwände und natürlich auch Unsicherheiten. Die Verordnung betrifft etwa Epoxidharz-basierte Innenbeschichtungen, für die es aber Alternativmaterialien gibt. Auch mit den Polycarbonatgebinden beispielsweise auf Wasserspendern haben wir ein Problem. Sie müssen jetzt ausgetauscht werden und im Moment gibt es keine wirkliche gute Alternative. Jede Ersatzsubstanz muss dafür sorgen, dass das Ergebnis, also der Werkstoff, die Verpackung, ihre besondere Funktionalität behält. Anders ist der Fall bei Membranen zur Flüssigkeitsaufbereitung wie der Entalkoholisierung von Bier – hier hat es eine Ausnahme gegeben. Ebenfalls anders ist die Situation bei Gießformen, die beispielsweise in der Süßwarenindustrie für Schokoladentafeln, Gummibärchen oder im Konditorenhandwerk genutzt werden. Bisher haben wir hier keine Alternative gefunden. Wir befinden uns immer noch in einem Prozess, der unter starkem Zeitdruck stattfindet und viel Geld kostet. Insgesamt haben die Verantwortlichen bei der Ausgestaltung der Verordnung wichtige Fragen, wie Kontaktzeiten und Migrationsrisiko, nicht berücksichtigt. Stattdessen liegt nun eine Fassung vor, in der fast jedes Lebensmittelkontaktmaterial gleich behandelt wird.
Zum Teil müssen Produktionsanlagen mit BPA-haltigen Bauteilen umgerüstet und alternative Materialien gefunden werden. Das bedeutet höhere Kosten, Aufwände und natürlich auch Unsicherheiten. Die Verordnung betrifft etwa Epoxidharz-basierte Innenbeschichtungen, für die es aber Alternativmaterialien gibt. Auch mit den Polycarbonatgebinden beispielsweise auf Wasserspendern haben wir ein Problem. Sie müssen jetzt ausgetauscht werden und im Moment gibt es keine wirkliche gute Alternative. Jede Ersatzsubstanz muss dafür sorgen, dass das Ergebnis, also der Werkstoff, die Verpackung, ihre besondere Funktionalität behält. Anders ist der Fall bei Membranen zur Flüssigkeitsaufbereitung wie der Entalkoholisierung von Bier – hier hat es eine Ausnahme gegeben. Ebenfalls anders ist die Situation bei Gießformen, die beispielsweise in der Süßwarenindustrie für Schokoladentafeln, Gummibärchen oder im Konditorenhandwerk genutzt werden. Bisher haben wir hier keine Alternative gefunden. Wir befinden uns immer noch in einem Prozess, der unter starkem Zeitdruck stattfindet und viel Geld kostet. Insgesamt haben die Verantwortlichen bei der Ausgestaltung der Verordnung wichtige Fragen, wie Kontaktzeiten und Migrationsrisiko, nicht berücksichtigt. Stattdessen liegt nun eine Fassung vor, in der fast jedes Lebensmittelkontaktmaterial gleich behandelt wird.
Was wünschen Sie sich von der Politik?
Ein bisschen mehr Maß und Ziel und weniger Getriebenheit durch NGOs und Umweltorganisationen wäre gut. Das konnten wir hier sehen, das kann man auch an anderer Stelle sehen. Ich sage ja nicht, dass es keine berechtigten Gründe gibt und für sichere Lebensmittel und sichere Packstoffe aus einer intakten Umwelt. Das will ich persönlich auch. Aber die Verhältnismäßigkeit geht immer häufiger verloren.